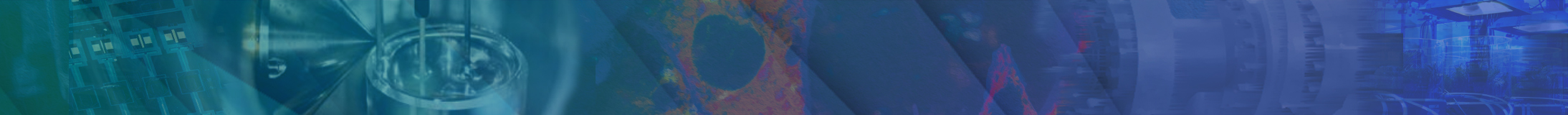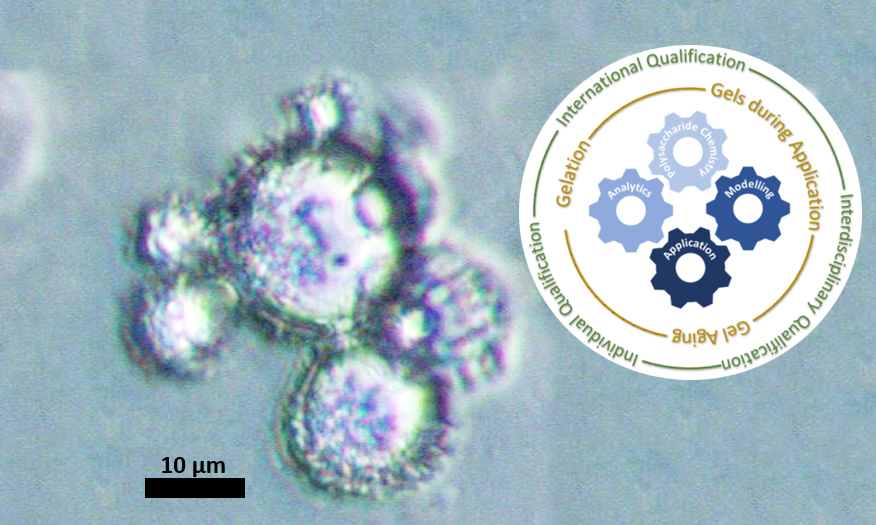DFG-geförderte Graduiertenschule SusGel zu nachhaltigen Hydrogelen
2025 bewilligte die DFG das neue Graduiertenkolleg SusGel – kurz für Sustainable Hydrogels bzw. nachhaltige Hydrogele. Forschende des KIT und der Universität Stuttgart arbeiten hierbei interdisziplinär zusammen, um Biopolymere aus nachwachsenden Quellen von den chemischen Strukturen bis zur Anwendbarkeit zu untersuchen. Zu den hauptverantwortlichen Antragsstellenden gehört KIT-Nachwuchsgruppenleiterin und derzeitige Vertretungsprofessorin Ulrike van der Schaaf. Im Interview berichtet sie über die Besonderheiten des Förderformats und ihre Motivation sich zu beteiligen.
Welche Vorteile hat es, sich als Nachwuchswissenschaftlerin in einem Graduiertenkolleg zu engagieren?
Zunächst einmal ist es für das eigene Portfolio immer gut, eine erfolgreiche DFG-Förderung zu haben. Auf meinem Gebiet ist es gar nicht so einfach, einen DFG-Antrag durchzubringen, da es für die Lebensmittelverfahrenstechnik keine eigene Fachgruppe in der Systematik der DFG gibt. Für die Lebensmittelchemie sind wir zu ingenieurslastig und für die Bioverfahrenstechnik sind wir oft nicht biologisch genug. Ein Graduiertenkolleg verfolgt hingegen einen interdisziplinären Ansatz, so dass wir hier gut mit reinpassen. Das Förderformat bietet eine tolle Chance in den Austausch zu kommen. Ich finde, es bringt einen extrem viel weiter, bessere Einblicke in Nachbardisziplinen wie Chemie, Physik, aber auch andere Forschungsrichtungen im Bio- und Chemieingenieurwesens zu erhalten. Man erweitert seinen Horizont, indem man mit anderen an gemeinsam Forschungsthemen arbeitet und so neue Denkweisen und Methoden kennenlernt.
Habt Ihr als antragstellende Forschendengruppe schon im Vorfeld zusammengearbeitet?
Nein, wir haben uns explizit für diesen Antrag zusammengefunden. Die zwei Sprecher des Graduiertenkollegs haben thematisch passende Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler angesprochen und dann gab es eine große Findungsrunde, in der jeder vorgestellt hat, was er oder sie beitragen könnte. Danach gab es noch Einzelgespräche mit den Sprechern und diese haben dann ein stimmiges Gesamtkonzept erstellt. Der ganze Prozess bis zum Förderentscheid hat gut eineinhalb Jahre gedauert.
Macht die DFG dazu Vorgaben?
Ja, alle Beteiligten müssen grundsätzlich an einem Standort sein, um den engen regelmäßigen Austausch zu gewährleisten. Neben dem KIT haben wir noch einen Partner an der Universität Stuttgart, was aufgrund der räumlichen Nähe machbar war. Wir wollten ursprünglich noch jemanden dabeihaben, der weiter weg war, aber das ging dann doch nicht. Zudem möchte die DFG auch, dass Nachwuchswissenschaftlerinnen und -wissenschaftler integriert werden. Es ist explizit gewünscht, dass junge Leute unter den Antragstellenden sind. Allerdings müssen diese nachweisen können, dass sie bereits Promovierende betreut haben. Die DFG fragt die Namen der Betreuten ab und wo diese mittlerweile gelandet sind. Zudem sollte sich der eigene Vertrag bestenfalls über die Laufzeit der ersten Förderphase erstrecken. Die DFG fragt hier nach und es ist vorteilhaft, wenn eine Entfristung in Aussicht steht bzw. wenn es einen Tenure-Track gibt. Und natürlich sollen auch Frauen dabei sein. Bei unserem Antrag fiel der DFG negativ auf, dass es so wenige Frauen sind. Aber sie haben dann festgestellt, dass es in dem Themenfeld einfach keine anderen Frauen gibt und das haben sie dann akzeptiert. Grundsätzlich soll die Gruppe der Antragstellenden 5-10 Personen umfassen.
Was wird genau gefördert?
Die erste Förderphase umfasst fünf Jahre und zwei Promotionsstellen pro Arbeitsgruppe. Insgesamt soll es drei Kohorten an Promovierenden geben. Die ersten zwei bekommt man direkt finanziert und für die dritte muss man sich nochmal neu bewerben. Dies läuft dann gemeinsam mit dem Fortsetzungsantrag für die zweite Förderphase des Graduiertenkollegs, die weitere vier Jahre umfasst. Beantragen kann man neben dem Gehalt der Promovierenden, Sachmittel für Laborverbrauchsmaterial, Publikationskosten und Mittel für Maßnahmen zur Chancengleichheit. Wir haben zudem eine halbe Sekretariatsstelle erhalten. Darüber hinaus hatten wir noch Reisemittel für Strategietreffen sowie eine Postdoc-Stelle in koordinierender Funktion beantragt. Diese wurden uns jedoch gestrichen.
Wie ist das Aufwand-Nutzen-Verhältnis verglichen mit anderen Förderformaten?
Wenn man nicht gerade Sprecher und Koordinator des Antrags ist, ist das Aufwand-Nutzen-Verhältnis sehr gut. Neben dem materiellen Wert profitiert man ebenfalls vom Netzwerken und dem Prestige der Förderung. Für die Antragsskizze habe ich ca. 5 Seiten zu meinem Teilprojekt und den Arbeitspaketen für die zwei Promotionsstellen eingereicht. Kommt der Antrag in die zweite Runde, gibt es eine Begehung vor Ort mit Vorträgen, Fragerunde und Poster-Session. Hier werden sowohl die Forschungsthemen als auch allgemeine Themen wie Internationales und Chancengleichheit präsentiert. Die Begutachtung insgesamt war sehr entspannt und es war echt angenehm, sich mit den Gutachtern der DFG zu unterhalten.
Neben dem Forschungsprogramm muss für die Bewerbung um ein Graduiertenkolleg auch ein Qualifizierungs- und Betreuungskonzept vorgelegt werden. Was braucht es dafür?
Da beim Graduiertenkolleg die Ausbildung der Promovierenden im Vordergrund steht, fällt dem Qualifizierungskonzept eine super wichtige Rolle zu. Dafür darf und muss man auch auf KIT-Strukturen, wie das Karlsruhe House of Young Scientists (KHYS) oder die Personalentwicklung zurückgreifen. Ohne diese wäre der Antrag nicht so erfolgreich gewesen. Auf Chancengleichheitsmaßnahmen wird ebenfalls sehr viel Wert gelegt. Zudem mussten wir zum allgemeinen Qualifizierungsprogramm angeben, wie viele Meetings in der großen Runde zum Austausch vorgesehen sind, aber auch welche Workshops und Gastrednerbeiträge geplant sind. Gerade aus der Industrie können potentielle Kooperationspartner oder spätere Arbeitgeber stammen. Es reichte hier nicht zu sagen, wir laden irgendwen ein, sondern man muss eine Liste mit Namen bereitstellen. Gleiches galt für mögliche Partnereinrichtungen für Auslandsaufenthalte. Zudem muss man für jeden geförderten Promovierenden einen weiteren aus anderen Mitteln gegenfinanzieren. Diese arbeiten auf verwandten Gebieten und durchlaufen dasselbe Qualifizierungsprogramm. Die Promovierenden einer Kohorte starten jeweils gemeinsam am selben Tag und bilden so einen festen Klassenverbund. Zudem haben der Promovierenden jeweils ein Zweierteam an Betreuenden, das sich fachlich ergänzt.
Wie wichtig ist die Zusammenarbeit zwischen den unterschiedlichen Arbeitsgruppen innerhalb des Kollegs?
Die DFG achtet explizit auf die Interaktion zwischen den einzelnen Arbeitsgruppen. Wir hatten vorab viele Abstimmungen untereinander, um herauszufinden, wie wir am besten zusammenarbeiten können. Es macht also nicht jeder seins, sondern wir mussten konkret darlegen, wie wir von der Arbeit der anderen profitieren und Synergien schaffen – also beispielsweise: ich kann den Rohstoff von Gruppe A nehmen und diesen weiterverwenden und ich brauche die Daten von Gruppe B1, um damit meine Struktur zu erklären. Gleichzeitig ist es wichtig, dass ich nicht auf die Ergebnisse der anderen angewiesen bin. Wäre die Abhängigkeit so groß, dass ich ohne die Beiträge der andren gar nicht arbeiten kann, ist es auch wieder schlecht. Optimalerweise entsteht ein riesiger Mehrwert, wenn alles klappt und die Ergebnisse ineinandergreifen, aber wenn etwas nicht funktioniert, sollten trotzdem alle Promovierenden ihre Projekte gut abschließen können.