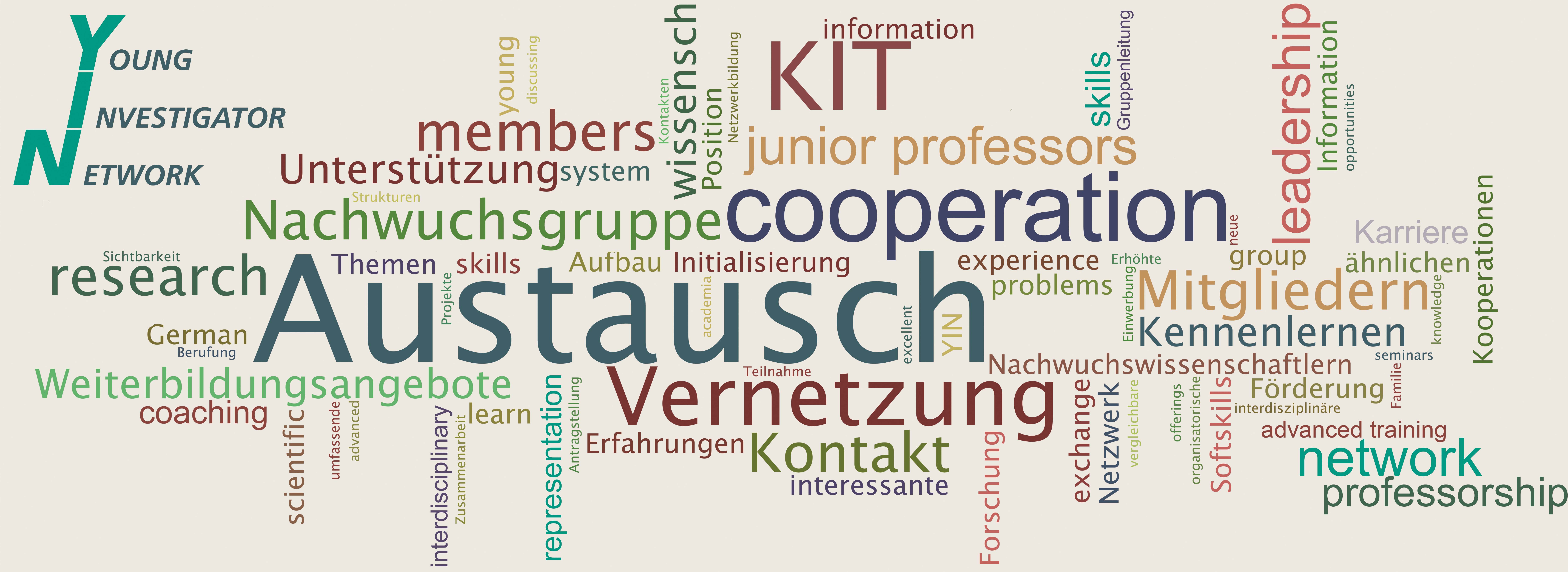The Young Investigator Network is the platform and democratic representation of interests for independent junior research group leaders and junior professors at the Karlsruhe Institut of Technology.
Peer Community
Interessensvertretung
Weiterbildung
Führung in der Wissenschaft
Individueller Support
Fördermöglichkeiten

Vom Nordatlantik bis nach Westeuropa entwickeln sich hurrikanähnliche Winterstürme, die Schäden in Millionenhöhe verursachen und das Leben von Menschen gefährden. „Eine genaue Vorhersage des Ortes, des Zeitpunkts und der Intensität solcher Extremwetterereignisse ist bisher eine Herausforderung“, so Annika Oertel. Viele der physikalischen Prozesse finden über dem Atlantik statt – einem Gebiet, das reguläre Beobachtungssysteme nur unzureichend erfassen. Die groß angelegte Messkampagne NAWDIC soll nun mit flugzeug- und bodengebundenen Beobachtungen der Atmosphäre dazu beitragen, Wettervorhersagen und Klimamodelle zu verbessern.
Presseinfo
Elektronisches Hardware-Design, mathematisches Theorembeweisen und die Überprüfung der Sicherheit kritischer Systeme sind nur einige Beispiele für den Einsatz von Automatischem Schlussfolgern. "Wir verstehen Automatisches Schlussfolgern als die algorithmische Erkundung eines formalen Regelsatzes, um präzise beweisbare Eigenschaften abzuleiten", sagt Dominik Schreiber. Seine Gruppe forscht an der Schnittstelle von Algorithmendesign, parallelem Rechnen sowie formalen Methoden und entwickelt effiziente Lösungsverfahren für logische Probleme.
more
Im Tandem mit Anke Kläver gewann Franziska Meinherz eine Förderung im Rahmen des Margarete von Wrangell Juniorprofessorinnen-Programms. Dieses Programm des Baden-Württemberg Ministeriums für Wissenschaft, Forschung und Kunst fördert dreijährige Tandems zwischen frisch promovierten Postdoc-Forscherinnen und Juniorprofessorinnen. Franziska Meinherz und Anke Kläver bewarben sich mit dem Projekt “Das Aufkommen von Fahrradkurierfahrenden: Auswirkungen auf die Politik des Radfahrens”. Im Interview verrät Franziska Meinherz, wie beide von dem Tandem profitieren.
Interview